
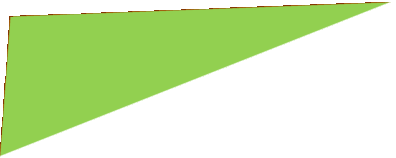
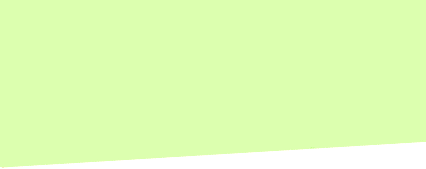
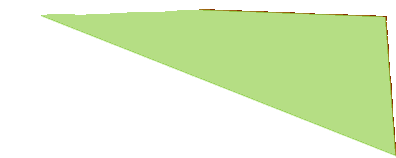
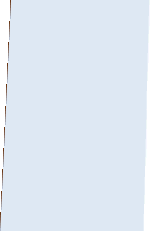
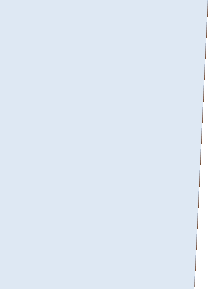
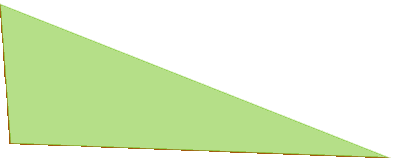
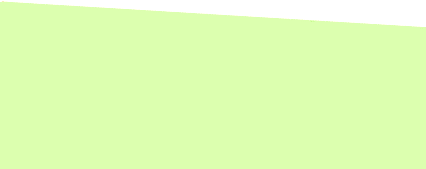
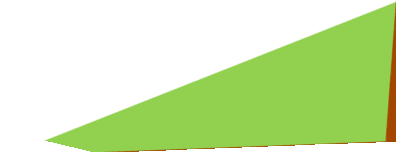

Am Anfang war das Flachdach
Bei uns gibt es ein schräges, 11 x 11 Meter großes Flachdach über Garagen und Schuppen. Das Problem bei Flachdächern ist bekanntermaßen die Dichtheit. Lasse sich bloß keiner einreden Flachdächer wären irgendwie mit normalen Mitteln auf Dauer dicht zu bekommen.
Üblicherweise (so auch bei uns) werden Flachdächer mit Dachpappen, Schweißbahnen, Bitumen usw. abgedichtet. Sie sind dann auch dicht - zumindest eine Weile. Dummerweise bleibt das nicht so. Die Verbindung der Schweißbahnen wird durch die Witterung rissig, in der Sonne verläuft Bitumen, ... Auch mit darauf befindlichem Kies ist nur eine Verzögerung erreichbar.
Dann kam das Wellplastik
So hatten wir die Idee, es mit Wellplastik zu versuchen. Die bis dahin praktisch jährlich anfallenden Wartungsarbeiten am Dach entfielen in der Tat.
Leider erwies sich auch das Wellplastik nicht als ideal. Erster Knackpunkt sind die Schrauben. Hier aufgesetzte Hütchen, das wussten wir bereits, halten nur ein bis drei Jahre, dann sind sie hinüber. Sie zerbröseln einfach. Also entschieden wir uns für eine Abdichtung mit Silikon. Dummerweise dehnt sich das Wellplastik sehr stark, sodass irgendwann das Silikon nicht mehr hundertprozentig dicht ist. Und auch das Wellplastik ist nicht UV-beständig. Es wird immer spröder und schließlich auch undicht.
Immerhin würde das bedeuten, dass sich der bis dahin jährliche Wartungsaufwand nun auf alle 7 - 10 Jahre verlängert, wobei dann allerdings alles komplett erneuert werden muss. Das war also auch nicht ideal.
Ein weiterer Kritikpunkt ist, dass Wellplastik ebenso hässlich ist, wie die Dachpappenlösung. Direkt an das Dach anschließend haben wir eine etwa einen Meter tiefer gelegene Hochterrasse, die im Sommer auch entsprechend genutzt wird, sodass der Anblick doch nicht so ideal ist.
Ein Spitzdach könnte die Lösung sein
Bekanntermaßen sind die Spitz-/Satteldächer die Dächer mit dem wenigsten Wartungsaufwand. Diese Pfannendächer sind einfach immer dicht, wenn nicht gerade ein Sturm ein paar Pfannen verschiebt oder herunter weht. Also was lag näher, als ein Spitzdach auf die Garagen zu setzen? Den darunter befindlichen Raum kann man sogar noch als Abstellfläche nutzen.
Ein Satz mit X. Das war wohl nix
Schnell waren entsprechende Pläne bei den zuständigen Stellen zur Genehmigung vorgelegt. Dann kam das unglaubliche: Unser Ansinnen wurde abgelehnt. Sämtliche Einsprüche brachten keinen Erfolg. Was dabei besonders schmerzt, ist die Begründung für die Ablehnung: Wir wohnen in einem Landschaftsschutzgebiet! So etwas Idiotisches ist uns noch nicht untergekommen!
Ein Landschaftsschutzgebiet, das keins ist
Direkt hinter unserem Haus, im Süden, ungefähr 20 m vom Garagendach entfernt verläuft die größte Autobahn Deutschlands. Die A2 ist an dieser Stelle zehnspurig.
Im Norden, also vor unserem Haus, befindet sich ein intensivst bewirtschafteter Acker. Alles was es an Herbiziden, Pestiziden und Düngern gibt wird dort in Unmengen verwendet. Die Rebhühner, Kiebitze, Feldlerchen usw., die ich als Kind noch erleben durfte, gibt es schon lange nicht mehr.
Dreihundert Meter von unserem Haus in Richtung Westen gab es einmal einen wirklich schönen alten Wald. Der gehört zwar bereits zu einer anderen Stadt. Hier würde ich eine Einstufung als Landschaftsschutzgebiet jedoch akzeptieren, wenn es ihn noch in der ursprünglichen Form geben würde. Gibt es aber nicht mehr, da riesige Schneisen in den Wald geschlagen wurden, um dort eine Hochspannungsleitungstrasse durchzuführen.
Aus ist es mit den herrlichen Sonnenuntergängen. Man kann sie nur noch hinter Gittern genießen. Jedenfalls sieht es so aus, wenn die Sonne hinter den Hochspannungsleitungen untergeht. Nebenbei, unser Dach wäre im Vergleich zu den 90 m hohen Türmen kaum ins Gewicht gefallen, zumal in unserer Stichstraße sowieso kaum einer das von der Straße aus nach hinten versetzte Dach entdeckt hätte.
Ach ja es bleibt der Osten. Dort befindet sich das Nachbarhaus und daneben der zugehörige Garten und ein Hobbygeflügelzücher. Von unberührter oder schützenswerter Natur ist also auch hier nichts zu sehen. Ein paar Meter weiter ist das Landschaftsschutzgebiet zu Ende.
Wenn also in der Stadt Dortmund von großen Naturschutzgebieten die Rede ist, weiß man ja nun, was man davon zu halten hat.
"Was tun?", sprach Zeus
Nun hatten wir ein Problem. Nach einiger Überlegung kamen wir dann zu der heutigen Lösung. Schon oft hatte ich auf diversen Messen und Ausstellungen die Möglichkeiten, ein Dach zu begrünen, bewundert. Leider waren die Aussteller ausschließlich Gärtner, die natürlich mit gleichzeitiger Abdichtung nichts zu tun hatten (Heute sieht das etwas anders aus, da viele Gärtner bereits mit Dachdeckern zusammenarbeiten. Nur kann das kaum einer bezahlen). Trotzdem war das der im Weiteren verfolgte Ansatz, wobei wir auch noch ein anderes Problem in den Griff bekommen wollten, die Temperatur in den Schuppen und Garagen.
Die Dachbegrünung
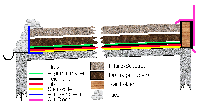
Der Aufbau des Dachs
(27K-gif)
Zur Vorbereitung wurden an den Seiten und der Vorderseite des Dachs Holzbalken an gedübelt, die eine Mauer von etwa 20 cm Höhe und einer Breite von 8 cm bildeten. Das Gefälle des Dachs ging zur freigebliebenen Seite. Vor die dort befindliche Regenrinne wurde ein etwa 20 cm hohes Alu-Lochblech gesetzt. So erhielten wir eine Wanne für das Substrat. Doch dazu später mehr.
Wärmedämmung
Ein Problem neben der Undichtigkeit war immer die Temperatur. Im Sommer brauchte nur 2 - 3 Tage die Sonne zu scheinen. Dann war es in den Schuppen und Garagen nicht mehr auszuhalten. Die Innentemperatur entsprach weitgehend der Außentemperatur. Daher legten wir als unterste Schicht Steinwolle auf dem Dach aus. Darauf Filzbahnen, damit sich bei der weiteren Arbeit die Steinwolle nicht verschieben sollte.
Allein dadurch konnten wir (die Arbeiten wurden im Sommer durchgeführt) eine immense Verbesserung feststellen. Die Temperatur schlug nicht mehr durch. Es blieb erheblich kühler unter dem Dach.
Abdichten
Zum Abdichten nahmen wir Teichfolie!
Sie war verhältnismäßig leicht verlegt und mit einem
Kaltschweißmittel verklebt. Ich hatte darin schon Übung, da ich bereits
diverse Gartenteiche und eine Bachlauf angelegt habe
(Vielleicht schreibe ich auch mal darüber).
Die Folie wurde über die Balken gelegt und von außen mit Pappnägeln befestigt. Vor dem Lochgitter endet die Folie. Das allein sollte zu Abdichten genügen. Die Folien sind Witterungs- und UV-beständig mit einer mindestens zehnjährigen Garantie. Aber ohne Befestigung oder Beschwerung auf der Fläche wäre sie von jedem mittleren Sturm losgerissen worden. Und es sollte ja auch begrünt werden. Um die Folie über den Balken vor der Sonne zu schützen (sie soll schließlich ewig und nicht nur zehn Jahre halten) wurden die Balken inkl. Folie noch von einem Alu-Blech umschlossen, das ebenfalls von außen befestigt wurde.
Bodengrund
Begrünt werden sollte das Dach. Also musste Bodengrund aufs Dach. Da sich der gewünschte magere Bodengrund eigentlich als besserer Schotter bezeichnen ließe, es also unzählige kleine spitze Steinchen gab, die die Folie bei Begehung eventuell durchstoßen könnten, haben wir auf die Folie Altgummimatten (siehe hierzu die Ergänzungen am Ende) gelegt und darauf die erste, etwas gröbere Substratschicht, die als Drainage dienen sollte, aufgebracht.
Darüber kam Flies, um die Schichten voneinander zu trennen. Darauf kam das Pflanzsubstrat. Insgesamt war die Substratschicht so hoch, wie die Balken.
Die Lochblechseite wurde von der Regenrinnenseite her mit einem etwa 30 - 40 cm breiten und ungefähr 10 cm über das Substrat ragenden Berg aus Kieselsteinen überdeckt. Das sollte als Filter für die zu Beginn zu erwartenden Ausspülungen des Substrats dienen und bei Austrocknung des Substrats und aufkommenden Wind eine Belästigung durch herum wirbelnden Staub verhindern. Das hat sich bewährt, zumindest die Filterfunktion. Entgegen unserer Erwartungen hat es nämlich nie Staub gegeben. Die Steine hätten also nicht unbedingt über das Substrat herausragen müssen da nie etwas herum wirbelte.
Ebenfalls gegen die eventuell mögliche Belästigung gegen Staub wurde vor die Balkenseiten ein 50 cm hohes Alu-Blech genagelt. Staub gab es jedoch tatsächlich nie. Inzwischen ist das Dach genug begrünt, um nur noch wenig (zukünftig keine) freie Substratfläche, die vom Wind erreicht werden könnte, erkennen zu lassen. Das Substrat selbst ist übrigens so miteinander verbunden, dass schon ein mittlerer Sturm kommen müsste, um etwas von Dach zu wehen. Mit anderen Worten: Das zusätzliche Alu-Blech ist aus heutiger Sicht unnötig gewesen (siehe hierzu die Ergänzungen am Ende).
Begrünung
120 Quadratmeter zu begrünen kann ganz schön ins Geld gehen. Glücklicherweise hatte sich mein Bruder dazu entschlossen, den verwilderten Garten seines Hauses in eine Spielwiese für seine Kinder umzuwandeln. Dabei fielen für mich riesige Mengen Mauerpfeffer ab, mit denen ich fast die Hälfte des Daches bepflanzen konnte. Diese Pflanze ist so anspruchslos, dass sie sogar auf glatten Steinen wachsen würde. Für eine Erstbepflanzung ist sie zudem noch ideal, weil sie später hinzukommenden Pflanzen ausweicht. Sie wird also von fast allen anderen Pflanzen verdrängt. Einer späteren Umgestaltung des Dachs steht damit also nichts im Wege.
Natürlich konnten wir auch anderweitig einige geeignete Pflanzen ergattern. Aber nicht genug, sodass trotzdem gekauft werden musste. Allerdings haben wir uns damit Zeit gelassen, sodass das Dach auch heute (das war bis 2001 so) noch nicht vollständig begrünt ist. Ein paar Stellen bleiben übrigens immer frei, da es immer ein paar Pflanzen gibt, die den Winter nicht komplett überstehen. Sie füllen im Verlauf des Sommers diese Lücken aber immer wieder aus.
Wir haben fast ausschließlich Sedum-Arten (Siehe Bilder am Ende) für die
Bepflanzung verwendet.
Diese Pflanzen haben mehrere Vorteile. Sie vertragen jede Temperatur
und sehr lange Trockenperioden. Insbesondere der zweite Punkt ist wichtig.
Sollten nämlich auf dem Dach trotz des mageren Bodens einmal
unerwünschte Wildkräuter gedeihen, sind sie bei einer solchen
Trockenphase schnell wieder verschwunden. Oberstes Gebot bei unserer Art der
Dachbegrünung ist es deshalb
niemals zu gießen!
Dummerweise spielte uns das Wetter der letzten Jahre einen Streich, sodass
solche Trockenperioden zu selten vorkamen, wir jedoch reichlich Regenzeiten
hatten. Wir mussten also doch - wenn auch im Vergleich zu einem Garten sehr
selten - auf das Dach, um etwas weg zu zupfen.
Zuviel Regen ist auch einigen unserer Pflanzen nicht gut bekommen. Einige Hauswurze und ein Teil der winterharten, gegen alle Temperaturen gefeiten südamerikanischen Hochgebirgskakteen faulten leider ganz oder zumindest teilweise weg.
Mit dem Dach haben wir jedenfalls alle unsere Ziele erreicht:
- Es ist dicht
- Kaum Wartungsaufwand (nur sehr seltenes Unkraut zupfen)
- Ausgezeichnete Wärmedämmung (Inzwischen muss man schon im Sommer die Türen öffnen, um etwas Wärme in die Räume zu bekommen)
- Es sieht toll aus!
Bildergalerie
Vielleicht hat mein Bericht ja dem Einen oder Anderen als Anregung dienen können, es selbst einmal zu versuchen. Es lohnt sich, wie die folgenden Bilder zeigen sollen.
|
Das 1998er Regenjahr hat aber etwa die Hälfte verfaulen lassen, was aber bei dieser Pflanze nicht weiter schlimm ist, da zwischen den faulen Stellen immer noch etwas steht. Und das verbreitet sich so stark, dass im Frühjahr 1999 schon fast nichts mehr von den zerstörten Flächen zu sehen ist. Nachtrag 2005: Da die zurückliegenden Winter alle extrem feucht waren, hat der Mauerpfeffer inzwischen noch weiter gelitten, sodass im Sommer nicht mehr alle Lücken geschlossen wurden. Aber im Großen und Ganzen hält er sich immer noch ganz gut. Das hinter der Baumwurzel rosa blühende Fettgewächs hatte 1998 auch den Kampf gegen den Regen verloren. Aber 1999 kommt es so langsam wieder nach. Nachtrag 2012: Drei kalte und extrem Niederschlagsarme Winter habe den Mauerpfeffer so gut getan, dass er nun wieder über das ganze Dach verbreitet ist. |
Nachtrag 2005: Die letzten Winter haben die Pflanze nun doch dahingerafft: Es ist einfach zu feucht gewesen. Da sie aber immerhin ein paar Jahre durchgehalten hat und wir auf trockenere Winter hoffen, werden wir sie uns bei Gelegenheit wieder zulegen. Die dahinter (vor dem Birkenstamm) stehenden Hauswurze haben unterschiedlich auf das Mistwetter reagiert. Die gelbblühenden (siehe auch Bild unten) sind 1999 ebenso prächtig wie im Vorjahr. Die rosa blühenden sind völlig verfault und kommen auch nicht wieder. Schade eigentlich. Sie hatten sich schon schön vermehrt. Die werden wir aber wieder holen, in der Hoffnung, dass es solch ein Regenjahr so schnell nicht wieder gibt. Nachtrag 2005: Die Hauswurze sind nicht mehr so konzentriert auf engem Raum zusammen, sondern verteilen sich auf größere Gebiete (mit mehr Lücken dazwischen). Das ist nicht ganz so auffällig, sieht aber immer noch gut aus. |
 Immer wiederkehrende Mittagsblume im Frühjahr 1999 (50K-jpg) Diese Blume blüht jetzt zum ersten Mal, obwohl sie bereits im dritten Jahr hier steht. Ich habe sie leider etwas zu spät fotografiert. Da war sie schon teilweise verblüht. Nachtrag 2005: Diese Blume ist nach einigen Jahren eingegangen |
 Im Vordergrund Zwergnelken, dahinter Kaktus und hinter Baumwurzel Glockenblume im Frühjahr 1999 (38K-jpg) |
|
|
|
|
 Eine weitere Nelkenart, die sich inzwischen selbst verbreitet hat im Frühjahr 1999 (66K-jpg) Nachtrag 2005: Sie hat sich noch mehr in vielen, weit verteilten kleinen Büscheln verbreitet |
|
|
|
|
|
|
 Blühende Glockenblume im Frühjahr 1999 (47K-jpg) Nachtrag 2003: Diese Blume hat sich leicht vermehrt und es blühen jetzt jedes Jahr ein paar davon, ohne das Dach jedoch zu sehr zu dominieren. |
|
|
|
||
|
Dieser Kaktus ist einer der winterharten Kakteen in Blüte.
Dieser hier hatte insgesamt 14 Blüten
von denen jede einzelne höchstens 3 Tage blühte.
Da nie mehr als 3 gleichzeitig
blühten, hatten wir mehr als eine Woche unseren Spaß daran. Nachtrag 2003: Er blühte seit dem jedes Jahr so viel; manchmal sogar noch mehr. |
||
|
|
|
|
Die Bilder werden, wenn neue vorliegen, ergänzt oder auch ausgetauscht.
Schaut einfach öfter mal vorbei, um neue Eindrücke zu gewinnen.
Nachtrag 2003: So glaubte ich mal. Da wir am Dach danach fast nichts mehr
gemacht haben (war nicht nötig, da es uns so bereits gut gefällt),
gab es auch kaum Veränderungen. Jedenfalls keine so großen, dass ein
zusätzliches Foto nötig wäre
Ergänzungen
Viele E-Mails zum Thema der Dachbegrünung zeigen mir, dass es einigen Ergänzungsbedarf gibt.
Materialbeschaffung
Häufig werde ich nach den Möglichkeiten zur Beschaffung der Materialien gefragt.
Es ist wirklich nicht ganz leicht an die Materialien heranzukommen. Wenn ich jetzt Anbieter nennen würde, hätte das vermutlich wenig Sinn, es sei denn, das neu zu begrünende Dach würde sich in Dortmund oder in der näheren Umgebung befinden (Selbst da muss ich inzwischen passen, da ich die Adressen und Rechnungen nicht mehr finde).
Bei meinen ersten Recherchen zur Materialbeschaffung ist eigentlich immer alles an den Frachtkosten gescheitert! Diese lagen oft doppelt so hoch, wie der Materialpreis.
Daher hier nun einige Hinweise:
- Teichfolie
- Baumärkte, Garten- oder Zoogeschäfte.
- Flies und Bodensubstrat
- In (Spezial-)Gärtnereien erkundigen.
Dort kann man das Substrat bestellen. Oder man bestellt dort eine
kleinere Menge Substrat,
um dann den Rest direkt vom Zulieferer zu beziehen.
Auf das Dach muss das Substrat auch noch: Wer nicht gerade über haufenweise Geld verfügt muss dabei wohl in den sauren Apfel beißen und es selbst aufs Dach befördern. Das funktioniert z.B. mit Eimern: Seil dran, vollschaufeln und hoch damit. Ist verdammt langwierig und anstrengend, aber man schätzt es dann umso mehr! - Pflanzen
- (Spezial-)Gärtnereien, Nachbarn, Verwandte, ...
- Alles Übrige
- Baumärkte und Fach(groß)handel.
Erfahrungen
Nichts ist so gut, dass man es nicht noch verbessern könnte.
Zukünftig würde ich folgende Änderungen vornehmen:
- "Windfang"
- Die über die Bodenhöhe des Substrats hinausgehenden "Windschutzbleche" würde ich weglassen. Das Substrat sieht zwar so aus, als würde es schnell wegfliegen, das ist aber nicht so.
- Drainage
-
Zukünftig würde ich eventuell eine zusätzliche
Drainage unter das Substrat verlegen.
Es gibt harte Folien, die, über die gesamte Fläche verteilt,
Erhebungen aufweisen,
unter denen das Wasser ablaufen könnte. Das Substrat speichert
mehr Wasser als ich dachte,
sodass es, insbesondere in den letzten, eher verregneten
Jahren, bei uns etwas zu feucht bleibt,
was den Trockenheit-liebenden Pflanzen nicht so recht behagt.
Das wäre allerdings kein MUSS, da die Pflanzen sich immer wieder erholen und das Dach eigentlich zu jeder Jahreszeit gut aussieht. Es wäre nur mal eine Überlegung wert. - Altgummimatten
- Die Altgummimatten haben den Sinn, zu verhindern, dass sich eventuell scharfe und/oder spitze Steinchen des Substrats bei der Begehung durch die Folie drücken. Da diese aus Altgummi hergestellten Matten verdammt teuer waren und ich feststellen konnte, dass das Flies, welches die zwei Substratschichten voneinander trennt, zäh genug ist, um ebenfalls keine Steine durchdrücken zu lassen, würde ich jetzt auf das Flies ausweichen und dieses direkt auf die Folie legen. Eventuell mit einer Drainage-Folie (s.o.) darauf oder darunter.
zurück zum Anfang der Seite
Schlusswort
Wenn ihr durch die verschiedenen Themen unserer Homepage durch seid,
dann schreibt uns doch einfach mal, wie es euch gefallen hat. Es ist
einfach interessant zu erfahren, wie unsere Homepage so ankommt.
Schreibt bitte in das
Gästebuch
oder schickt eine
E-Mail
Diese Homepage ist unter folgenden URLs zu erreichen:
- http://www.familie-sandmeier.de/
- http://www.elfen-welt.de/ (direkt zu Ullas Elfenwelt
- http://www.elfenvolk.de/ (direkt zu Ullas Elfenwelt
- http://www.maerchen-welt.de/ (direkt zu unseren Märchen
Copyright
Da ich alles selbst geschrieben, gezeichnet, fotografiert und gestaltet habe, erhebe ich auch den Anspruch, es als mein Eigentum zu betrachten.
Jegliche nichtkommerzielle Nutzung ist jedoch erlaubt, sofern ein Hinweis auf die Quelle erfolgt. Wer also irgendetwas nutzen will, soll es tun, solange er meinen Namen und die E-Mail-Adresse oder den URL meiner Seite angibt. Ein Link auf meine Seiten ist stets willkommen!
Jede kommerzielle Nutzung oder Verbreitung, auch in Shareware- oder Freeware-Form ist ohne mein Einverständnis grundsätzlich nicht erlaubt. Achtung: Auch die private Nutzung ist ohne die oben angegebenen Hinweise verboten!
Näheres hierzu steht in den Copyright-Bedingungen
zurück zum Anfang der Seite














